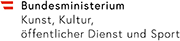Goschka Gawlik,
Geh und spiel mit dem Riesen! Kindheit Emanzipation und Kritik.: Kontrollierter Spaß
Das 20. Jahrhundert brachte den Kindern in der Gesellschaft eine gewisse Emanzipation. Schon vorher erfand man den Kindergarten als geschützten Raum für ihre Freizeitspiele. In heutigen Städten gibt es meist zu wenig Platz für ihre Aktivitäten, dafür aber viele (betonierte) Schutzräume, die kritische Aufklärer als Käfige betrachten. Ebenso verkümmert die Natur zur Mangelware - nach J.J. Rousseau - eine der wichtigsten Lehrmeisterinnen des Kindes und seiner freien Erziehung.
Wie sieht also die kindliche Emanzipation aus der künstlerischen Sicht heute aus? Sind Kinder andere Menschen oder kleine Erwachsene? Danach fragt die aufwendige und vielschichtige Ausstellung Geh und spiel mit dem Riesen! Kindheit, Emanzipation und Kritik. Ihre Kuratorinnen - Anne Marr und Eva Maria Stadler – wollen dabei mit dem Kanon einer üblichen, seitens der Museumspädagogik konzipierten Kinderpräsentation brechen.
Was will man heute mit der Erziehung des Kindes zwischen „Biegen“ und „Brechen“ seiner Ungehorsamkeit überhaupt erreichen? Nicht alle Arbeiten in dieser auf drei Etagen der Villa Stuck gezeigten Ausstellung sind für Kinder leicht nachvollzierbar. Viele gesellschaftliche, kulturelle oder politische Aspekte wollen erst erprobt und erlernt werden. Eine partizipatorische Erfahrung beim Anschauen der Kunstwerke bietet zweifellos die modulhafte und multifunktionale Ausstellungsarchitektur, die von der deutschen Künstlerin Mirjam Thomann entworfen wurde. Sie nennt sich humorvoll „Raum für dicke Kinder und schlechte Laune“. Das Raummodell aus weißen Rastern persifliert diverse moderne Spielplatzeinrichtungen und kann von Kindern in ihrem sprichwörtlichen Drang nach Bewegung vielfach benutzt werden. An einigen Holzplanken kleben allerdings Betonklumpen, die gegen Rationalität und Disziplin leise opponieren. Hygienisch Weiß und einladend zur Bewegung sind ebenso Nils Normans 8 übergroße Modelle von Kristallen, die als Beispiele der Naturanschauung und für spielerische Didaktik stehen. Diese ist in der Ausstellung durch die Methodik einflussreicher Reformpädagogen wie Friedrich Fröbel oder Maria Montessori ständig präsent. Und so können Kinder und Erwachsene gleichermaßen „14 Spielgaben“ zum Vorgang des Webens anhand der zur Verfügung gestellten Materialien an Ort und Stelle fleißig üben. Die Fröbelsche Pädagogik soll ja auch die Malereien von Mondrian, Klee und Albers sowie u.a. die Architektur von Le Corbusier entschieden geprägt haben.
Auf die riesenhaften, ausgestopfte und in poppige Muster gekleidete Stoffkraken von Cosima von Bonin darf man sich nicht setzen, so wie man von der Decke hängende und zusammengeballte Plüschbären – die Arbeit von Mike Kelly - nicht berühren darf. Stattdessen darf jeder den sich aus den sterilen Plastik-Rhomben, die Plüschtiere spitz konterkarieren, flüchtigen Zitronenduft einatmen und so eine klinische Sinnlichkeit genießen. Die choreographische Installation von Nicolaus Couturier, die aus einer Vielzahl beschrifteter Holzstäbe besteht, frönt weiter dem mehrfachen Beugen und Kriechen und stellt für die jungen Erwachsenen einen völlig neuen Leseraum dar. Auf Schritt und Tritt begegnet man in der Ausstellung als begehbaren Attrappen fungierende Skulpturen des Dänen Jakob Kolding. Seine grafischen Menschen- und Tierfiguren - ein Tiger, eine Eule oder ein gesichtsloser Mensch - offenbaren beim Umhergehen ihre schreckhafte Zweideutigkeit. Damit entziehen sie sich kinderleichter Perzeption und Analyse und lassen hier ihre Wirkung spüren.
So richtig austoben kann man sich ausschließlich im Garten. Dort hat Heimo Zobernig ein bühnenhaftes „Spielgerät“, aus den Buchstaben des Wortes Apropos verflochten, aufgebaut und damit neben Bewegung auch Sprache ins Spiel gebracht. Um die Bauarten körperlicher Zurichtung geht es auch in dem hinter kühlem Glas meisterlich gesetztem Großaquarell von Thomas Eggerer. Darin verurteilt der deutsche Maler die erzieherischen Strukturen moderner Architektur deutlich mit einem „dislike“. Um einprägsame Klischees, die mit dem Kindsein verbunden sind, kommt die Münchner Präsentation nicht herum. Dschungel, Riesen, Monster, Roboter und Kawaii sind die Themen, auf die sich die hier gezeigten Objekte, Malerei, Fotografien oder Videos beziehen. Ihr Leitmotiv, das Wechselspiel zwischen Kind- und Erwachsensein kündigt bereits das erste Exponat – das Selbstporträt von Oswald Oberhuber – an. Es zeigt die Spaltung des Ichs in unterschiedliche Zeitzonen der eigenen Subjektivität und erzählt davon, wie sich unser Verständnis der bipolaren Unterscheidung zwischen Kind- und Erwachsensein allmählich auflöst. Insgesamt vermittelt die Show dank des architektonischen Displays den Eindruck eines übergreifenden Netzwerkes mit der Ambition, möglichst empirisch zu sein. Lesenswert jedenfalls der Ausstellungskatalog: hier gibt es Eintragungen von Kindern, die darin enthaltene Texte mit eigenen Worten kommentieren.
 Mehr Texte von Goschka Gawlik
Mehr Texte von Goschka Gawlik
 Mehr Texte von Goschka Gawlik
Mehr Texte von Goschka Gawlik
Geh und spiel mit dem Riesen! Kindheit Emanzipation und Kritik.
11.10.2015 - 10.01.2016
Museum Villa Stuck
81675 München, Prinzregentenstrasse 60
Tel: +49 89 455 55 10, Fax: +49 89 455 55 124
Email: villastuck@muenchen.de
http://www.villastuck.de/
Öffnungszeiten: Mi - So, 11.00 - 18.00
11.10.2015 - 10.01.2016
Museum Villa Stuck
81675 München, Prinzregentenstrasse 60
Tel: +49 89 455 55 10, Fax: +49 89 455 55 124
Email: villastuck@muenchen.de
http://www.villastuck.de/
Öffnungszeiten: Mi - So, 11.00 - 18.00


 Teilen
Teilen