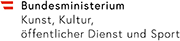Nina Schedlmayer,
Die Witwe
Vorige Woche starb die Surrealistin Dorothea Tanning. Sie war 102 Jahre alt. Es erschienen nur wenige Nachrufe, in Österreich gar keine, in Deutschland und im englischsprachigen Raum einige eher kurz gehaltene. Zumeist wurde sie darin als „Witwe von Max Ernst“ vorgestellt; häufig druckte man nicht einmal ein Porträt von ihr alleine, sondern eines, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Gatten posierte.
Dass in Österreich keines der Mainstream-Medien über Tanning berichtete, liegt schlicht daran, dass sie hier völlig unbekannt ist. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, in Wien jemals etwas von ihr gesehen zu haben; vielleicht trügt mich auch das Gedächtnis, das wäre jedenfalls schön. Woran ich mich hingegen erinnern kann, ist ein Gespräch mit einem Professor am Wiener Kunstgeschichte-Institut, irgendwann um das Jahr 2000 herum. In Zusammenhang mit irgendeiner von mir zu verfassenden schriftlichen Arbeit kam die Rede auf Künstlerinnen der Avantgarde. Der Professor war kein Mittelalter- oder Barockspezialist, sondern beschäftigte sich bevorzugt mit der Moderne. Im Dadaismus, meinte er, da gäbe es Hannah Höch, auch im russischen Konstruktivismus hätten Künstlerinnen eine wichtige Rolle gespielt – aber im Surrealismus, da fiele ihm jetzt keine einzige weibliche Vertreterin ein. Als ich ihn auf Meret Oppenheim und Dorothea Tanning hinwies, blickte er nur ratlos. War es möglich, dass er, der Moderne-Experte, sie nicht einmal kannte? Anscheinend schon.
Es ist merkwürdig: Einzelne Künstlerinnen werden verehrt, ja nahezu heilig gesprochen, zum Beispiel Georgia O’Keeffe, Louise Bourgeois, Frida Kahlo, Niki de Saint Phalle, Marina Abramovi? oder Cindy Sherman, in Österreich Maria Lassnig und Valie Export; kaum ein Fleckchen aus ihrem Werk wurde noch nicht erforscht und präsentiert. Andererseits wird in großen Überblicksschauen – wie zuletzt in „elles@centrepompidou“ (siehe auch die artmagazine Kritik) – demonstriert, was Künstlerinnen im vorigen und aktuellen Jahrhundert geschaffen haben. Doch irgendwie scheint die Sache dann ins Stocken zu geraten.
Ansonsten wären solche Phänomene wie Dorothea Tanning nicht erklärbar: Der österreichische Bibliothekskatalog verzeichnet gerade einmal sieben Titel unter ihrem Namen – großteils Aufsätze in thematischen Sammelpublikationen –, im deutschen sieht es ebenso trist aus. Monografische Ausstellungen im deutschsprachigen Raum wird man auch vergeblich suchen. Dabei wäre ihr Werk wirklich eine größere Einzelpräsentation wert. Ebenso wie das von Hannah Höch, Sophie Täuber-Arp, Leonora Carrington, Helen Frankenthaler, Joan Mitchell, Agnes Martin und so weiter. Doch offenbar ist es interessanter, immer und immer wieder männliche Heroen abzufeiern (und noch auf die eine oder andere Valie-Export-Ausstellung verweisen zu können), als endlich tatsächlich anzuerkennen, dass künstlerische Qualität kein Geschlecht hat.
 Mehr Texte von Nina Schedlmayer
Mehr Texte von Nina Schedlmayer
 Mehr Texte von Nina Schedlmayer
Mehr Texte von Nina Schedlmayer 

 Teilen
Teilen