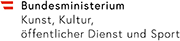Rainer Metzger,
Duchamps Tür
Zugegeben, ich war noch nie in Philadelphia. Ich habe noch nie das Werk Marcel Duchamps gesehen, wie es dort ziemlich erschöpfend ausgebreitet ist. Ich halte den Meister insgesamt nicht gerade für unterschätzt. Und sein letztes Stück Kunst, das er in klandestiner Großtuerei in 20 Jahren ins Werk gesetzt hat und auf den Titel „Gegeben sei: 1. Der Wasserfall, 2. Das Leuchtgas“ brachte, finde ich in seiner Inszenierung eines Voyeurismus der Einäugigkeit ziemlich platt. Nun hat Hans Belting Duchamps Holzverschlag und vor allem seiner Rezeption ein Bändchen mit Überlegungen gewidmet. Belting ist einer der Kronzeugen für die neulich vom Direktor der Deutschen Forschungsgemeinschaft geäußerte Meinung, dass die deutschsprachige Forschung auf zwei Gebieten weltweit führend sei: der Archäologie und der Kunstgeschichte.
Schon in seinem 1998er „Das unsichtbare Meisterwerk“ war Belting mit Duchamp beschäftigt, vor allem mit dessen „Großem Glas“, das er als Travestie des Prinzips Chef d’Oeuvre las. Dann kam Beltings anthropologische Wende, er schrieb eine 2001 publizierte „Bild-Anthropologie“, und die Suche nach dem Allgemein Menschlichen hinter dem Piktoralen ließ ihn vor allem ein Phänomen, das als abendländische Errungenschaft schlechthin firmiert, neu lokalisieren. Die Zentralperspektive, die Hymne auf das große Ego, die ihre Provenienz nach ziemlich einhelliger Ansicht bis dato aus Florenz bezogen hatte, wurde nun Bagdad zuerkannt, ausgerechnet der Hauptstadt von Saddam Hussein, und Beltings 2008 veröffentlichte These – die allerdings nicht ganz neu war, sondern immer schon im Verborgenen blühte – war jedenfalls aufsehenerregend.
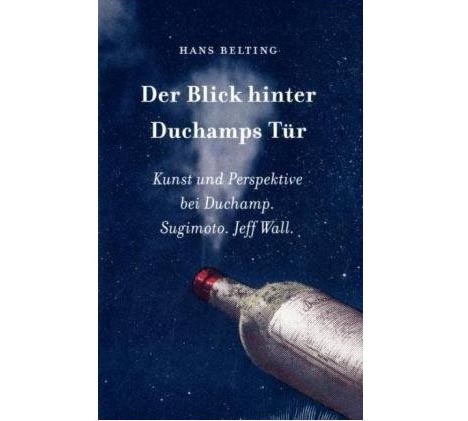 Hans Belting, Der Blick hinter Duchamps Tür. Kunst und Perspektive bei Duchamp. Sugimoto. Jeff Wall, Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König 2009
Das mit der Perspektive hat Belting jetzt weiterverfolgt, und Duchamp, der nicht nur eine Junggesellen-, sondern eben auch eine Sehmaschine konstruiert hat, liefert ihm die Möglichkeit, den Gedanken wieder im nordatlantischen Raum zu lancieren. Und sie in die erweiterte Gegenwart zu verlängern, denn sein Buch erzählt von einer Trias: Es behandelt laut Untertitel „Kunst und Perspektive bei Duchamp. Sugimoto. Jeff Wall“. Die beiden letzteren haben unabhängig voneinander, aber ziemlich gleichzeitig hinter Duchamps Tür geblickt, als die Installation 1973/74 zu dessen Retrospektive in Philadelphia in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückte. Und sowohl Hiroshi Sugimoto als auch Wall haben Mitte der Siebziger die Strategien entwickelt, für die sie heute berühmt sind. Belting sagt nun, das hinge mit der Schlüssellochperspektive zusammen, die sie damals vor Duchamps Dunkelkammer einnahmen.
Wenn Sugimoto und Wall Dinge vor die Linse rücken, deren man ohne Kamera nicht gewahr würde oder die es ohne fotografisches Arrangement überhaupt nicht gäbe: Dann, sagt Belting, haben sie von Duchamp gelernt. Doch wer hat das nicht? „We’re only in it for the Manet“ titelte einst Dan Graham, Frank Zappas Album-Titel „We’re only in it for the money“ auf hübsche Weise paraphrasierend. Jeff Wall wäre der Letzte, der das bestritte. Nun ist ihm ein neues Programm auferlegt: We’re only in it for the Duchamp.
Hans Belting, Der Blick hinter Duchamps Tür. Kunst und Perspektive bei Duchamp. Sugimoto. Jeff Wall, Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König 2009
Das mit der Perspektive hat Belting jetzt weiterverfolgt, und Duchamp, der nicht nur eine Junggesellen-, sondern eben auch eine Sehmaschine konstruiert hat, liefert ihm die Möglichkeit, den Gedanken wieder im nordatlantischen Raum zu lancieren. Und sie in die erweiterte Gegenwart zu verlängern, denn sein Buch erzählt von einer Trias: Es behandelt laut Untertitel „Kunst und Perspektive bei Duchamp. Sugimoto. Jeff Wall“. Die beiden letzteren haben unabhängig voneinander, aber ziemlich gleichzeitig hinter Duchamps Tür geblickt, als die Installation 1973/74 zu dessen Retrospektive in Philadelphia in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückte. Und sowohl Hiroshi Sugimoto als auch Wall haben Mitte der Siebziger die Strategien entwickelt, für die sie heute berühmt sind. Belting sagt nun, das hinge mit der Schlüssellochperspektive zusammen, die sie damals vor Duchamps Dunkelkammer einnahmen.
Wenn Sugimoto und Wall Dinge vor die Linse rücken, deren man ohne Kamera nicht gewahr würde oder die es ohne fotografisches Arrangement überhaupt nicht gäbe: Dann, sagt Belting, haben sie von Duchamp gelernt. Doch wer hat das nicht? „We’re only in it for the Manet“ titelte einst Dan Graham, Frank Zappas Album-Titel „We’re only in it for the money“ auf hübsche Weise paraphrasierend. Jeff Wall wäre der Letzte, der das bestritte. Nun ist ihm ein neues Programm auferlegt: We’re only in it for the Duchamp.
 Mehr Texte von Rainer Metzger
Mehr Texte von Rainer Metzger
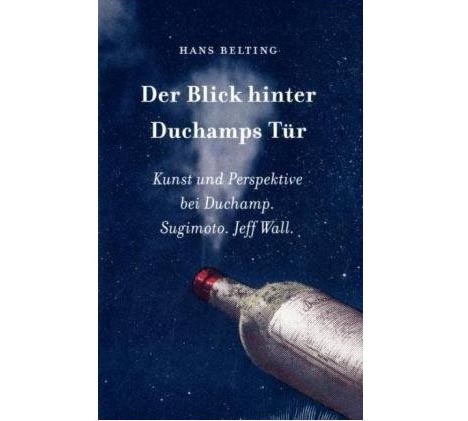 Hans Belting, Der Blick hinter Duchamps Tür. Kunst und Perspektive bei Duchamp. Sugimoto. Jeff Wall, Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König 2009
Das mit der Perspektive hat Belting jetzt weiterverfolgt, und Duchamp, der nicht nur eine Junggesellen-, sondern eben auch eine Sehmaschine konstruiert hat, liefert ihm die Möglichkeit, den Gedanken wieder im nordatlantischen Raum zu lancieren. Und sie in die erweiterte Gegenwart zu verlängern, denn sein Buch erzählt von einer Trias: Es behandelt laut Untertitel „Kunst und Perspektive bei Duchamp. Sugimoto. Jeff Wall“. Die beiden letzteren haben unabhängig voneinander, aber ziemlich gleichzeitig hinter Duchamps Tür geblickt, als die Installation 1973/74 zu dessen Retrospektive in Philadelphia in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückte. Und sowohl Hiroshi Sugimoto als auch Wall haben Mitte der Siebziger die Strategien entwickelt, für die sie heute berühmt sind. Belting sagt nun, das hinge mit der Schlüssellochperspektive zusammen, die sie damals vor Duchamps Dunkelkammer einnahmen.
Wenn Sugimoto und Wall Dinge vor die Linse rücken, deren man ohne Kamera nicht gewahr würde oder die es ohne fotografisches Arrangement überhaupt nicht gäbe: Dann, sagt Belting, haben sie von Duchamp gelernt. Doch wer hat das nicht? „We’re only in it for the Manet“ titelte einst Dan Graham, Frank Zappas Album-Titel „We’re only in it for the money“ auf hübsche Weise paraphrasierend. Jeff Wall wäre der Letzte, der das bestritte. Nun ist ihm ein neues Programm auferlegt: We’re only in it for the Duchamp.
Hans Belting, Der Blick hinter Duchamps Tür. Kunst und Perspektive bei Duchamp. Sugimoto. Jeff Wall, Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König 2009
Das mit der Perspektive hat Belting jetzt weiterverfolgt, und Duchamp, der nicht nur eine Junggesellen-, sondern eben auch eine Sehmaschine konstruiert hat, liefert ihm die Möglichkeit, den Gedanken wieder im nordatlantischen Raum zu lancieren. Und sie in die erweiterte Gegenwart zu verlängern, denn sein Buch erzählt von einer Trias: Es behandelt laut Untertitel „Kunst und Perspektive bei Duchamp. Sugimoto. Jeff Wall“. Die beiden letzteren haben unabhängig voneinander, aber ziemlich gleichzeitig hinter Duchamps Tür geblickt, als die Installation 1973/74 zu dessen Retrospektive in Philadelphia in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückte. Und sowohl Hiroshi Sugimoto als auch Wall haben Mitte der Siebziger die Strategien entwickelt, für die sie heute berühmt sind. Belting sagt nun, das hinge mit der Schlüssellochperspektive zusammen, die sie damals vor Duchamps Dunkelkammer einnahmen.
Wenn Sugimoto und Wall Dinge vor die Linse rücken, deren man ohne Kamera nicht gewahr würde oder die es ohne fotografisches Arrangement überhaupt nicht gäbe: Dann, sagt Belting, haben sie von Duchamp gelernt. Doch wer hat das nicht? „We’re only in it for the Manet“ titelte einst Dan Graham, Frank Zappas Album-Titel „We’re only in it for the money“ auf hübsche Weise paraphrasierend. Jeff Wall wäre der Letzte, der das bestritte. Nun ist ihm ein neues Programm auferlegt: We’re only in it for the Duchamp.
 Mehr Texte von Rainer Metzger
Mehr Texte von Rainer Metzger 

 Teilen
Teilen