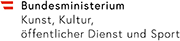Andrea Winklbauer,
Filmgeschichte im Superformat
Die 70-mm Filmretrospektive auf der 59. Berlinale
Als immer mehr Menschen in die Städte zogen und die Natur nicht mehr primär ihre Lebensbedingungen diktierte, geschah es, dass selbst unordentliches Gestrüpp in den Augen seiner Betrachter schön zu erscheinen begann. "Landschaft" wurde zu einer weitläufigen Kategorie. Innovationen lassen das schon Dagewesene nicht einfach nur alt aussehen. Manchmal bewirken sie sogar das Gegenteil. Um die Mitte des 20. Jahrhunderts war es der Siegeszug des Fernsehens, der die Filmindustrie zur Ausweitung ihrer ureigensten Kampfzone zwang: der Leinwandprojektion. Breitwand war die teure, aber nicht dauerhaft erfolgreiche Antwort. Heute ist es wieder eine Innovation, die ein nostalgisches Interesse an der so gut wie nicht mehr verwendeten Technik der Projektion von 70-mm-Positiven weckt: Die Berlinale hat dieses Jahr mehr als die Hälfte ihrer Spielstätten mit digitalen Kino-Servern aufgerüstet, was der unaufhaltsamen Entwicklung weg von der klassischen Filmrolle hin zum digitalen Kino Rechnung trägt. Dafür ist die Retrospektive des Festivals in diesem Jahr weder einem Thema, noch einer ProtagonistIn der Kinogeschichte gewidmet, sondern mit dem Königsformat 70-mm einer ihrer aufsehenerregendsten Techniken.
Die 26 Titel der Reihe bieten auf, was man sich unter einem Filmprogramm im superbreiten Seitenverhältnis von 1:2,21 – in einigen Fällen ist es sogar noch extremer – vorstellt: Leinwandepen und Kolossalfilme, Abenteuer und Western, Musicals und Science-Fiction, Reise- und Landschaftsaufnahmen, zumeist in restaurierten Fassungen. Der älteste der gezeigten Filme stammt aus dem Jahr 1956, der jüngste aus 1999. Die meisten sind aber in den 1960er Jahren entstanden. Wer hier also Werke mit legendären Schauwerten wie William Wylers „Ben Hur“ (1958/59) mit Charlton Heston oder Joseph L. Mankiewicz „Cleopatra“ (1961-63) mit Liz Taylor und Richard Burton erwartet, wird nicht enttäuscht. Diese beiden Filme gehören ebenso logisch in eine 70-mm-Reihe wie „Playtime“ (1964-67) von Jacques Tati, Stanley Kubricks Science Fiction-Meilenstein „2001: A Space Odyssey“ (1965-68) oder „Woina i mir“ (1962-67), Sergeij Bondartschuks vierteilige Prestigeverfilmung von Leo Tolstois „Krieg und Frieden“ mit seinen abertausenden Statisten und der überwältigenden Pyrotechnik. Weniger bekannt sind die anderen drei sowjetischen Produktionen: „Dnewnyje swesdy“ (Tagessterne, 1966) von Igor Talankin, „Optimistitscheskaja tragedija“ (Optimistische Tragödie, 1963) von Samson Samsonow und der erste Sovscope-70-Film, Julia Solnzewas „Powest plamennych let“ (Flammende Jahre, 1960/61).
Die Opulenz des Breitwandfilms mit ihrer Bildgewalt, Farbenpracht, optischen Brillanz und einem ebensolchen Tonerlebnis ist heute eine Herausforderung an die moderne Kinotechnik: Es gibt kaum noch Kopierwerke und Lichtspieltheater mit der nötigen Ausstattung. In ganz Österreich etwa kämen dafür kaum noch vier Kinos in Frage, darunter das Leo in Innsbruck und das Gartenbau in Wien, dem aber die nötige Magnettonanlage fehlt. Das 1963 mit dem 70-mm-Film "Optimistische Tragödie" eröffnete Berlinale-Kino International musste für die Retrospektive auch erst rückgerüstet werden. Man hat den Eindruck, die Breitwand-Schau kommt gerade noch zur rechten Zeit. Wer weiß, welche neue Entwicklung daraus ensteht?
Mehr Texte von Andrea Winklbauer


 Teilen
Teilen