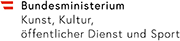Andrea Winklbauer,
Zauber der Ferne - Imaginäre Reisen im 19. Jahrhundert: Mit Grüßen vom Mond
Man hört es förmlich, das „Herrrrreinspaziert“, das den schaulustigen Praterbesucher zu einer kurzen Reise ohne Gepäck verführen sollte. Nach der Kassa, hinter einer Tür, einem Vorhang oder nur einer Absperrung trat man für kurze Zeit in fremde Länder ein. Der Wiener Prater, Ressort für vielerlei Illusionen, war im 19. und frühen 20. Jahrhundert auch ein Zentrum für imaginäre Reisen aller Art. So konnte man sich etwa am „Bahnhof Prater“ für wenig Geld in ein Abteil des „Eilzuges Wien – Konstantinopel“ setzen und erlebte, was frühe Zugsreisende beschrieben hatten: Wie die Landschaft an ihnen vorüber gezogen wurde. Man blieb selbst am selben Fleck, nur das „Moving Panorama“ bewegte sich. Selbst fantastische Reisen waren möglich wie eine Flugzeug- oder Raketenfahrt zum Mond. Zur Erinnerung konnte man Ansichtskarten mit einem „Gruß vom Nordpol“ oder einem „Gruß vom Meeresgrund“ verschicken. Der Höhepunkt der Reiseillusionen im Wiener Prater aber war mit Sicherheit der Themenpark „Venedig in Wien“, in dem man zwischen 1895 und 1901 zwischen Nachbildungen venezianischer Häuser und Sehenswürdigkeiten und auf richtigem Wasser herumgondeln konnte.
Die Prater-Spezialistin Ursula Storch hat in ihrer Ausstellung „Zauber der Ferne“ im Wien Museum aber noch weitaus mehr über imaginäres Reisen im 19. Jahrhundert zusammen getragen. Eigentlich fing es sogar schon im 18. Jahrhundert an, als staunende Europäer optische Zimmerreisen mittels Guckkästen unternahmen. Als 1787 der Ire Robert Barker das Panorama erfand, stand damit auch zugleich die Kulturindustrie am Anfang. Panoramen, riesige 360-Grad-Gemälde mit Ansichten von Landschaften oder Großstädten wie London, wurden in zylindrischen Bauten mit unterirdisch erreichbaren Betrachterplattformen in der Mitte ausgestellt und, der besseren Verwertbarkeit wegen, auch schon von Ort zu Ort geschickt. Die Laterna Magica, der Vorläufer des Dia-Projektors, erlaubte die Projektion ganzer Reisezyklen, von den Pyramiden bis zum Mond. Optik und künstliche Beleuchtung waren auch für den hochrealistischen Effekt von (den gemalten Bilder der) Kosmoramen entscheidend: Sie wurden sitzend durch Gucklöcher mit vergrößernden Gläsern betrachtet. Am „Kaiserpanorama“ saß man auch und betrachtete durch zwei eingebaute Linsen die vorüber ziehenden stereoskopischen Reisefotos, die dadurch einen dreidimensionalen Effekt erhielten.
Abgesehen von den optisch-technischen Reiseimaginationen verlustierte sich der Mensch des 19. Jahrhunderts gerne in nach fernen Ländern gestalteten Räumlichkeiten. Im Wiener Apollosaal gab es im Biedermeier eine exotische Gartenlandschaft zu bestaunen und das Vergnügungsetablissement „Neues Elysium“ ließ seinen Besucher in einer Abfolge von Räumen vier, später sogar fünf Kontinente durchwandern. Die Wiener Weltausstellung von 1973 erlaubte gleich den Besuch „der ganzen Welt“ an einem Ort und auch zahlreiche Feste des späteren 19. Jahrhunderts, nicht nur von Künstlern, entführten ihre Besucher für eine Nacht an einen fernen Ort.
Natürlich können die Objekte und Bilder, soweit noch vorhanden, im Zeitalter der Medien – und vor allem: der realen Fernreisen! – nicht mehr das sein, was sie für das sehnsüchtige Publikum der Vergangenheit waren: Wir fallen auf diese Illusionen nicht mehr herein. Aber dass das im Grunde sehr schade ist, macht diese schöne Ausstellung definitiv klar.
Mehr Texte von Andrea Winklbauer
Zauber der Ferne - Imaginäre Reisen im 19. Jahrhundert
04.12.2008 - 29.03.2009
Wien Museum
1040 Wien, Karlsplatz
Tel: +43 1 5058747-0, Fax: +43 1 5058747-7201
http://www.wienmuseum.at
Öffnungszeiten: Di-Fr 09-18, Sa, So 10-18 h
04.12.2008 - 29.03.2009
Wien Museum
1040 Wien, Karlsplatz
Tel: +43 1 5058747-0, Fax: +43 1 5058747-7201
http://www.wienmuseum.at
Öffnungszeiten: Di-Fr 09-18, Sa, So 10-18 h


 Teilen
Teilen