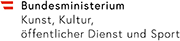Abgetrenntes Haupt um 624.000 Euro
Diesmal war es nicht der „Sex“ der sich gut verkaufte, sondern der Schauder des Todes, der für einen Rekordzuschlag bei einer Auktion sorgte. Wahrscheinlich um 1610 – 1615 hat Fede Galizia das Bild „Judith mit dem Haupt des Holofernes“ geschaffen, das am 3. Mai im Rahmen der Auktion Alte Meister im Dorotheum unter den Hammer kam. Versehen mit einem Schätzpreis von 200.00 bis 300.000 Euro erreichte das marktfrische Werk schließlich 624.000 Euro, inklusive Aufgeld. Acht Werke von sieben Künstlerinnen wurden in der Auktion angeboten. Großteils blieben sie im Bereich der Schätzungen, die meist zwischen 20.000 und 40.000 Euro lagen. Unverkauft blieben ein Tempera-Stilleben, das zuvor als Werk von Octavianus Monfort gegolten hatte und nun Giovanna Garzoni (1600 – 1670) zugeschrieben wird. Ebenfalls kein Interesse konnte ein Werk der wohl berühmtesten unter den wiederentdeckten Meisterinnen wecken. Das 144,5 mal 2 Meter messende Ölbild „Abraham und die drei Engel“ das Artemisia Gentileschi gemeinsam mit Onofrio Palumbo, einem Mitarbeiter ihrer Werkstatt in den 1640er Jahren geschaffen hat. Vielleicht liegt es eben daran, dass ein Schüler Gentileschis an der Arbeit beteiligt war, denn das Werk war vor knapp einem Jahr schon einmal unverkauft geblieben.
Es kommt also Bewegung in den Markt der Alten Meisterinnen, von denen immer mehr durch neue Zuschreibungen entdeckt werden. Denn obwohl viele von ihnen zu Lebzeiten geschätzte und erfolgreiche Malerinnen oft mit eigenen Werkstätten waren, wurden sie von der Kuntgeschichte der folgenden Jahrhunderte negiert. Viele Werke wurden von Historikern einfach Künstlern zugeschrieben, oder Signaturen von Händlern gefälscht, weil Maler in späterer Zeit als besser Verkäuflich galten. Dass das zu einem gewissen Grad immer noch so ist zeigt auch der Katalog der Altmeisterauktion, denn nicht signierte Bilder werden durchwegs etwa „Hofmalern“ zugeschrieben, obwohl mittlerweile bekannt ist, dass es viele Künstlerinnen in den Diensten von Adelshäusern gab. Und warum sollte das opulente Bouquet aus Tulpen, Lilien, Narzissen und andere Blüten in einer skulpturierten Vase denn so sicher von einem „Meister der Groteskenvasen“ geschaffen worden sein, und nicht von einer Meisterin?
 Mehr Texte von Werner Remm
Mehr Texte von Werner Remm 

 Teilen
Teilen