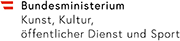Wer war Amalie Lauter?
Ob Heidi Goëss-Horten wohl jemals Ruth Klügers Buch „weiter leben. Eine Jugend“ gelesen hat? Deborah Feldmans „Überbitten“? Ob sie „Die letzten Zeugen“ im Burgtheater sah? Oder sich in irgendeiner Weise mit dem Holocaust befasst hat?
Amalie Lauter hieß die jüdische Vorbesitzerin jenes „arisierten“ Kaufhauses, das der verstorbene Ehemann von Goëss-Horten 1936 in Duisburg billigst erwarb. Die Geschäftsfrau wurde, schon fast 70 Jahre alt, 1942 in Auschwitz ermordet. Helmut Horten dagegen baute sein Geschäft aus, kaufte weitere Liegenschaften aus einst jüdischem Besitz, wurde „Reichsverteiler für Textilien“, der Laden brummte. Nach 1945 konnte er an seine Erfolge anschließen, scheffelte Milliarden.
In der Ausstellung der Sammlung Goëss-Hortens, demnächst im Leopold Museum, wird Amalie Lauter nicht erwähnt. Auch im Katalog kommt sie nicht vor. Überhaupt ist die ganze Geschichte um die NS-Arisierungen kein Thema. Doch wurzelt hier nicht jenes Vermögen, das den Erwerb der derart teuren Sammlung überhaupt erst möglich machte?
Dazu befragt, sagte Museumsdirektor Hans-Peter Wipplinger vorige Woche zu mir: „Die Frage ist, an welchem Zeitpunkt man mit der Geschichtsaufarbeitung anfängt. Anderen großen Sammlungen wie dem Louvre werden die politischen Verstrickungen bzw. Akquisitionen auch nicht vorgeworfen. Früher oder später finden die meisten großen Kunstwerke ohnedies Eingang in Museen. Überdies agiert Heidi Horten als Geschäftsfrau seit Jahrzehnten eigenständig und erfolgreich, was in Zeiten der Emanzipation Anerkennung finden sollte. Natürlich muss man über die Geschichte sprechen – aber die exzeptionelle Kollektion, die die Sammlerin zusammenstellte und der Öffentlichkeit zugänglich macht, hat es verdient, in den Fokus gerückt zu werden.“
All diese Argumente hinken angesichts des Entsetzens der Shoa. Der Vergleich zwischen dem absolutistischen Frankreich und Hitlerdeutschland erscheint hanebüchen, ebenso die angeblich so emanzipierte Eigenständigkeit einer Milliardenerbin, die ein schon gigantisches Vermögen mehrte (und damit, by the way, Kunst fast ausschließlich von Männern angekauft hat). Noch viel weniger taugt die Kollektion selbst als Schützenhilfe: Die Schönheit der Kunst vermag das Grauen der Geschichte niemals zu verdecken.
Kann man die Ursprünge jenes Unternehmens, mit dessen Gewinnen die Sammlung letztlich zusammengekauft wurde, ausklammern? Ich finde nicht. Schon gar nicht in diesem ohnehin schon belasteten Museum. Und noch weniger in einer Zeit, in der eine Partei mit dubiosem Geschichtsverständnis regiert. Da hilft auch das groß aufgeblasene Porträt der jungen Heidi Horten, die das Publikum begrüßt, nichts.
Nina Schedlmayer ist auch auf:
https://www.instagram.com/nina.schedlmayer/
--
Abbildung: Heidi Horten Collection auf Instagram
 Mehr Texte von Nina Schedlmayer
Mehr Texte von Nina Schedlmayer 

 Teilen
Teilen