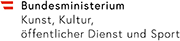Stefan Kobel,
Das Bauhaus als Schrank
Das Bauhaus wird 90. Während Deutschland gerade in Venedig mit seinem Pavillon demonstriert, wie folgenlos eine Einbauküche in der Kunst sein kann, hat ein schwedisches Möbelhaus seit Jahrzehnten weltweiten Erfolg mit der Adaption einiger Bauhaus-Prinzipien, die jedoch eher auf billige denn preiswerte Massenproduktion heruntergebrochen wurden. Um wie weit das Bauhaus selbst seinem hohlen Echo im intellektuellen Anspruch wie in der praktischen Umsetzung voraus war, demonstriert ein Kinderspielschrank, der am 20. Juni in einer bemerkenswerten Doppelauktion in München angeboten wird. Nicht umsonst hatte ihn der Architektur- und Kunstwissenschaftler Nikolaus Pevsner um 1924 erworben und 1933 mit ins Exil genommen. Die neun Teile lassen sich fast unendlich kombinieren und wachsen mit den Bedürfnissen von Kindern mit. Dabei ist das Ensemble so robust und zugleich ansprechend gefertigt, dass es in der Familie drei Generationen lang seinen Dienst verrichtete. Dem modernen Gedanken des Wegwerfmöbels läuft das natürlich zuwider, dem Bauhaus-Image von Stahlrohr und schwarzen Oberflächen allerdings auch. Dass dieses Bild der folgenreichsten Designschmiede der Welt tatsächlich nicht ganz korrekt ist, beweist die Auktion, zu der sich Ketterkunst und Quittenbaum zusammengetan haben. Die Flachware steuert der Allrounder bei, das Kunsthandwerk der Designspezialist.
 Mehr Texte von Stefan Kobel
Mehr Texte von Stefan Kobel
 Mehr Texte von Stefan Kobel
Mehr Texte von Stefan Kobel 

 Teilen
Teilen